11.04.2025 0 Kommentare
DDR-Geschichte im Konfikurs
DDR-Geschichte im Konfikurs
# Jugendliche

DDR-Geschichte im Konfikurs
Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden haben sich zu Beginn dieses Jahres intensiv mit ihrem Bekenntnis auseinandergesetzt. Sie haben sich mit dem Christsein in der DDR befasst und dabei verstanden, dass das christliche Bekenntnis nicht zu jeder Zeit so gut möglich war wie heute. Wir haben die Gedenkstätte für die Opfer politischer Gewaltherrschaft besucht und erfahren, dass die Musikschule, die viele heute wöchentlich besuchen, ein Ort mit einer schrecklichen Geschichte ist. Außerdem haben wir Eisenhüttenstadt erkundet: Wir haben das Museum Utopie und Alltag besucht und sind mit dem Architekten Martin Maleschka durch die Stadt, ins Evangelische Gemeindehaus und sogar das Hotel Lunik gewandert. Der Höhepunkt der Themeneinheit war jedoch zweifelsohne das Gespräch mit Zeitzeug*innen aus unserer Gemeinde und die Auseinandersetzung mit dem, was sie zu berichten hatten. Ganz herzlichen Dank an alle, die sich daran beteiligt haben. Einen kleinen Teil der mitunter sehr bewegenden Geschichten können Sie, liebe Leserinnen und Leser, hier nachvollziehen. Hinter den Fotos verbergen sich die Erinnerungen. Hätten Sie gedacht, wer darauf abgebildet ist?



Anne Kurth: Für mich war es schon schwer, in der Schulzeit (ich bin Jahrgang 1958) ausgegrenzt gewesen zu sein, weil ich aus einem christlichen Elternhaus kam. Kein Jungpionier, kein FDJ Mitglied und keine Jugendweihe. Aber die Gemeinschaft in der Kirche war was Besonderes. Mit acht Jahren lernte ich im Posaunenchor Trompete spielen und mit dem Chor machten wir viele schöne gemeinsame Ausflüge, spielten in Kirchen an der Ostsee in den Sommerferien. Die Christenlehrestunden waren so schön und prägend, dass Freundschaften bis heute bestehen. Dann als Junge Gemeinde trafen wir uns damals im Keller des Pfarrhauses (was für uns ein geschützter, behüteter Ort war), saßen auf Matratzen, spielten Gitarre und sangen Lieder, die wir auch zum Teil von jungen Christen aus der Partnergemeinde aus Moers bekamen. Wir trafen uns in den 80er Jahren öfter in Ostberlin mit Jugendlichen aus Moers. Da bestehen bis heute noch Freundschaften. Auch feierten wir als junge Gemeinde zusammen Silvester oder fuhren gemeinsam zum Zelten.
Und 2019 organisierten wir ein Treffen der ehemaligen Jungen Gemeinde im alten Pfarrhaus.
Für mich war als Christin in der DDR die christliche Gemeinschaft wichtig, der Zusammenhalten, offen mit dem Glauben umzugehen, sich nicht zu verstecken.
Die Fotos sind von unserer Rennsteigwanderung mit Zelt, Rucksack und Gitarre, vom Zelten am Schweriner See und von einer Silvesterfeier.

Mein Name ist Gudrun Kanzler. Ich bin die Oma von Emma Kanzler. Gern komme ich eurer Bitte nach, ein paar Zeilen, zur Bedeutung des Christseins für mich, in der DDR zu schreiben.
Ich bin am 24.02.1964 geboren und wurde am 12.07.1964 getauft. An meine Christenlehre- und Konfirmationsunterrichtszeit erinnere ich mich gern. Es waren schöne Stunden mit Gebeten, basteln, singen und Austausch mit gleichgesinnten Kindern und Jugendlichen.
Ich war eine Schülerin mit sehr guten und guten Noten. Da ich dem Sozialismus insoweit gegenüberstand, dass ich Jungpionier und Thälmannpionier wurde sowie in die FDJ eintrat, wurde das Christsein toleriert. Ich habe z.B. immer sehr darauf geachtet, zu jedem Anlass, bei welchem das Pionierhalstuch bzw. die FDJ-Bluse getragen werden mussten, das Halstuch bzw. die Bluse zu tragen, um nicht aufzufallen. Eine komplette Pionierkleidung wurde durch mein Elternhaus abgelehnt. Wenn die FDJ-Bluse getragen werden musste, habe ich mich nicht getraut, dazu eine Jeans zu tragen. So habe ich sehr jung gelernt, mich zu arrangieren.
Ich habe sehr gern im Schulchor gesungen. Am 01. Mai, dem „Internationalen Kampf- und Feiertag der Werktätigen für Frieden und Sozialismus“ in der DDR, wurde der Schulchor am frühen Morgen mit einem Bus in die umliegenden Dörfer gefahren, um ein einstudiertes Liedprogramm auf dem Dorfplatz zu singen. Mein Vater war immer dagegen, meine Mutter hat dafür gesorgt, dass ich teilnehmen darf.
Meine Mutter hat als Horterzieherin gearbeitet und stand kurz vor der Kündigung, als meine große Schwester konfirmiert werden wollte. Nachdem der Kompromiss geschlossen wurde, dass sie vorab an der Jugendweihe teilnimmt, durfte sie ein Jahr nach der Jugendweihe an der Konfirmation teilnehmen. Dieser Kompromiss galt dann auch für mich. Meine Jugendweihe war am 06.05.1978 und meine Konfirmation erhielt ich am 03.06.1979.
Das Christsein war nie ein Thema zwischen mir und meinen Freundinnen. Allerdings wurde auch nie mit ihnen über die schönen Christenlehre- und Konfirmationsstunden gesprochen.
Da ich den Beruf einer Verkäuferin erlernt und somit keinerlei weiterbildende Schule oder ein Studium benötigt habe, war ich in meinem Berufsleben durch mein Christsein nicht beeinträchtigt. Meiner großen Schwester hingegen war ein Studium nicht gestattet worden, obwohl sie auf ihren Zeugnissen nur Einsen hatte. Es war kein Elternteil in der SED und dann gab es noch den christlichen Hintergrund. Sie erlernte mit ihrem erheblichen geistigen Potential den Beruf einer Näherin.
Am 03.08.1985 habe ich standesamtlich geheiratet. Eine kirchliche Trauung wurde in Erwägung gezogen, jedoch nicht vollzogen. Mein Mann (auch getauft und konfirmiert) war Zivilangestellter in einem Forstbetrieb. Da war eine kirchliche Trauung nicht gewünscht. Als 1989 die Wende kam, war unser sofortiger Wunsch, die kirchliche Trauung nachzuholen.
Leider hatten wir am 26.12.1989 einen schweren Verkehrsunfall mit langer Genesungsphase. Dann haben wir unser Haus gebaut. Zu unserer 1987 geborenen Tochter kam 1991 noch ein Sohn dazu. Beide wurden am 04.06.2006 getauft und sind auch konfirmiert. So erfüllte sich der Wunsch der kirchlichen Trauung erst am 03.08.2000 in der Landkirche Lieberose an unserem 15. Hochzeitstag.
Jetzt, am 03.08.2025 begehen wir unseren 40. Hochzeitstag und nach unserer ersten Silberhochzeit am 03.08.2010 begehen wir unsere zweite Silberhochzeit - 25 Jahre kirchliche Trauung.



Regina Güldner: Neben den Schwierigkeiten und persönlichen Eingriffen in mein privates und berufliches Leben, wie Mobbing am Arbeitsplatz, Drohungen, meinen Kindern den Zugang zum Abitur zu verwehren, Verleumdungen und üble Nachrede bleibt mir in der Erinnerung vor allem eines wichtig: Das Aufgefangensein in unserer "Treff am Abend - Familie", dem Gesprächskreis, der noch heute aktiv ist und der mich gestärkt hat. Der Beistand und die tatkräftige Unterstützung durch den damaligen Superintendenten Rudolf Hanschel, der sich kämpferisch für mich bei den staatlichen Verantwortlichen für Kirchenfragen eingesetzt hat. Die Vermittlung von Pfarrer Jörg Hemmerling, die mir half, nach meinem faktischen "Berufsverbot" in der staatlichen Wirtschaft wieder beruflich Fuß zu fassen als Ökonomischer Leiter im Lutherstift.

Peter Fritsch: "In der DDR war auch nicht alles schlecht." So hieß ein oft belächelter Nachwendespruch. 1974 an der Helene hat er für diesen Moment gestimmt. Ansonsten: seit ihrer Gründung war es erklärtes Ziel der DDR Religion und Kirche als kleinbürgerlich bis klassenfeindlich zu überwinden. Die dazu geltenden „Ausführungsbestimmungen“ trafen Christen je nach ihrem Engagement und dem Eifer der jeweils zuständigen Obrigkeit in unterschiedlicher Härte.
Die bis ins kleinste reglementierte Wirtschaft war unfähig die Probleme des Landes zu lösen und gipfelte in dem Satz: "Der Sozialismus ist ein System zur Überwindung von Schwierigkeiten, die es ohne den Sozialismus gar nicht geben würde."

Reinhard Schülzke: Für mich bedeutete Christsein in der DDR, durch die Botschaft Jesu als ein freier und geliebter Mensch am Aufbau einer lebendigen und einladenden Kirche und einer gerechteren und friedlicheren Gesellschaft mitzuwirken. Die Botschaft Jesu erweckte in mir die Bereitschaft, mich aktiv persönlich und beruflich für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung im Land und in der Welt einzusetzen. In der Kinder- und Jugendarbeit konnte ich als Jugenddiakon (Kreisjugendwart) über die persönliche Begleitung und Hilfe hinaus zur Horizonterweiterung und zum Verständnis für ein Dasein für andere (Dreifachgebot der Liebe – Matthäus 22, 35-40) beitragen.
Foto: Kreisjugendkonvent 03.-05.10.1980 im Christophorus-Rüstzeitenheim an der Ragower Mühle
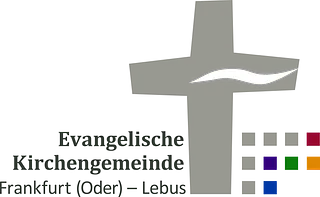

Kommentare